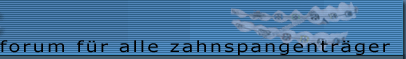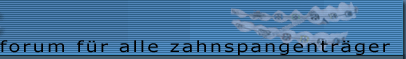Unsere Zähne sollten im Idealfall mit genügend Platz, aber ohne Lücken,
ordentlich in Reih und Glied stehen und stets so angeordnet sein: Die
oberen Frontzähne etwas vor den unteren, die sie ein wenig verdecken.
Die Seitenzähne müssen in Bruchteilen eines Millimeters exakt aufeinanderpassen
und "innig" verzahnt sein.
Mißverhältnisse zwischen Zahn- und Kiefergröße werden heute immer häufiger
festgestellt.
Für insgesamt 32 Zähne, die zeitlebens ihre Ursprungsgröße haben, ist
unser Kiefer oft nicht gebaut - vor allem im Unterkiefer treten häufig
Probleme auf. Zahnfehlstellungen haben etwas mit dem individuellen Platzangebot
zu tun, auch mit Vererbung. Es gibt Asymmetrien durch von vornherein
fehlende Zähne, und nicht zuletzt führen schlechte Gewohnheiten wie
z. B. Bleistiftkauen und Lippensaugen zu einem beeinträchtigten Zahnbild.
Gesunde Zähne ziehen?
Schiefstehende Zähne sind zum Beispiel ein Zeichen von Platzmangel im
Kiefer.
Der Fachzahnarzt muß einen Engstand der Frontzähne behandeln. Das führt
manchmal dazu, daß Zähne gezogen werden müssen.
Zahnlücken können auch erblich bedingt sein, etwa durch zu schmale seitliche
Schneidezähne. Ein zu schmaler Oberkiefer führt zu einem (beidseitigen)
"Kreuzbiß": Die oberen und die unteren Seitenzähne treffen
nicht regelrecht aufeinander. Die Folgen sind häufig ein gestörtes Wachstum
des Unterkiefers und Schwierigkeiten bei einer späteren prothetischen
Versorgung.
Vorstehende Schneidezähne, die sich auch bei geschlossenem Mund nicht
berühren ("Offener Biß") künden eventuell davon, daß viel
zu lange am Daumen gelutscht wurde. Ein "offener Biß" führt
manchmal zum Lispeln.
Daß die Zähne von Zivilisationsmenschen meist nicht wie Perlen an einer
Schnur aufgereiht sind, kann, muß aber nicht weiter bedenklich sein.
Viele leben damit glücklich und zufrieden. Doch oft ist es notwendig,
den Biß zu "entschärfen", um Schleimhauteinbisse, Zahnfleischverletzungen
oder Gleithindernisse zu vermeiden oder um die Beißfähigkeit zu verbessern.
Eine ebenmäßige Zahnreihe läßt sich zu dem leichter pflegen. Sie ist
weniger anfällig für Karies. Zahn- und Kieferanomalien können zu Kiefergelenksproblemen
führen, zu Kopfschmerzen und Bewegungseinschränkungen.
Doch auch ohne solche Beschwerden: Zähne, die kreuz und quer stehen,
sollen - das ist der Hauptgrund - meist schon aus ästhetischen Gründen
ordentlich zurück (oder vor) ins Glied treten. Die Initiative Kiefergesundheit,
hinter der die deutschen Kieferorthopäden stehen, wirbt mit dem Broschürentitel:
"Schöne Zähne - Spiegel Ihrer Persönlichkeit".
Realisieren läßt sich dies freilich nur, wenn kräftig nachgeholfen wird.
Denn ein "perfektes Gebiß" hat in unseren Regionen nur etwa
jeder zwanzigste Zeitgenosse. Leichtere Zahnfehlstellungen behandelt
der Allgemeinzahnarzt. Allerdings entpuppt sich manche vermeintlich
leichte Behandlung im weiteren Verlauf als schwierig: Muß mehr gerichtet
werden, ist der Kieferorthopäde gefordert. Oft geht es darum, das Wachstum
unterentwickelter Kieferteile anzuregen oder Knochenteile, die sich
zu stark entwickelt haben, in ihrer Wachstumsentwicklung zu hemmen.
Kieferorthopädisch behandelt werden zwischen 40 und 60 Prozent aller
Jugendlichen. In kieferorthopädischer Behandlung sind hierzulande mehr
als eine Million Menschen. Jedes Jahr kommen über 350 000 Patienten
neu in die kieferorthopädische Praxis. Etwa die Hälfte hat so gravierende
Fehlstellungen, daß sie mit festsitzenden Apparaturen korrigiert werden
müssen. Die meisten Patienten sind zwischen 9 und 13 Jahren alt.
Veränderungen der Zahnstellung erfolgen zwar meist im Kindesalter, aber
es ist nie zu spät, der Natur nachzuhelfen oder die Folgen schlechter
Angewohnheiten zu korrigieren.
Früh vorsorgen und vorbeugen
Durch eine Frühbebandlung kann man sich jedoch häufig spätere umfangreichere,
manchmal chirurgische Maßnahmen ersparen. Behandlungsbedürftige Kieferanomalien
sind in den meisten Fällen bereits im Milchgebiß sichtbar. Der Berufsverband
der Deutschen Kieferorthopäden bedauert, daß viele Patienten erst dann
zum Kieferorthopäden überwiesen werden, wenn sich eine Anomalie schon
recht deutlich ausgeprägt hat.
Auch könnte vielfach vorgesorgt werden:
- Durch frühzeitiges Abgewöhnen des Daumenlutschens wären spätere,
oft kosten- und zeitaufwendige Prozeduren nicht nötig.
- Vermieden werden muß die Zerstörung oder der Verlust von Milchzähnen:
Dies ist ein häufiger Grund für Zahnfehlstellungen. Denn die Milchzähne
sind Platzhalter für die bleibenden Zähne. Ist einer oder sind gar mehrere
nicht (mehr) vorhanden, gerät das gesamte System der endgültigen Platzzuteilung
ins Wanken: Nachbarzähne wandern in die Lücke, oder die falschen "Lückenbüßer"
kippen - und nehmen den nachwachsenden Zähnen den Platz.
Früher noch durchweg Grund für Hänseleien unter Kindern, werden herausnehmbare
Zahnspangen und nicht herausnehmbare, festsitzende Geräte (Brackets)
heute akzeptiert. Wir haben dazu Kinder befragt. Doch die anfängliche
Begeisterung läßt rasch nach: "Am Anfang war es toll und neu, aber
dann nicht mehr", sagt ein Junge. Ein Wunder ist das nicht. Denn
Zahnspangen müssen nicht nur konsequent und viele Stunden am Tage Monat
für Monat und Jahr um Jahr getragen werden. Die Zahnkorrektur, der stetige
Druck, mit dem Zähne in die richtige Richtung gedrängt werden, ist zum
Teil auch unangenehm.
Der Behandlungserfolg ist in erster Linie von der guten Mitarbeit des
Patienten abhängig. Um ihn zu erreichen, sind oft Tragezeiten von 16
Stunden pro Tag erforderlich. Wird diese Zeit zum Beispiel wegen Uneinsichtigkeit
oder manchmal auftretenden Schmerzen halbiert, ist das gewünschte Ergebnis
nicht zu erreichen. Es können sogar Schäden auftreten. Denn Zähne haben
die Tendenz, in ihre alte Stellung zurückzukehren. Ständiges Hin und
Her kann zu Zahnwurzelschädigungen führen.
Die Motivation muß bei einer langfristigen Behandlung immer wieder aufs
neue gestärkt werden. Hier sollte es ein Zusammenspiel von Eltern, Kind
und Arzt geben, um mehr oder minder lange Pausen beim Tragen zu vermeiden.
Denn Pausen verschaffen nur scheinbar Erleichterung. Sie verlängern
in der Regel die Tragedauer von ansonsten durchschnittlich zwei bis
vier Jahren sogar noch überproportional.
   |
Ronald,
9 Jahre,
mit starkem Überbiß und
zahlreichen Zahnfehlstellungen
am Ober- und Unterkiefer:
der Oberkiefer
vor Behandlungsbeginn. |
   |
Nach Behandlung
über 5 Jahre
stehen die meisten Zähne in
Reih und Glied. Der Überbiß
ist beseitigt, die Therapie aber
noch nicht ganz beendet. |
Die Aufgaben der Eltern
Viel Ausdauer, Konsequenz, Mühe und Überzeugungskraft sind also notwendig
- auch bei den Eltern, denen von ihren Kindern nicht selten etwas vorgespielt
wird. Ein Neunjähriger: "Ich nehme die Spange immer erst im Hochbett
raus, da kommen meine Eltern nicht mehr hin."
Pädagogischer Druck führt kaum zum Erfolg, hält Kinder nicht bei der
Spange. Beliebte Drohungen wie Taschengeldkürzungen oder "erzieherische"
Sprüche ("Wir erzählen unserem Kind, wie häßlich es aussieht, wenn
die Zähne nicht gerichtet werden"; "Manchmal muß man eben
laut werden"; "Wir erklären, daß im Fall des Nichttragens
die Kosten nicht zurückerstattet werden") wirken allenfalls kurzfristig.
Kinder, die bei der Spange bleiben sollen, wollen sachlich überzeugt
werden, weiß Dr. Erika Reihlen vom Zahnärztlichen Dienst in Berlin-Steglitz.
Es gibt spezielle Motivationsprogramme. Nur in Berlin werden im übrigen
alle Eltern von Kindern ab dem dritten Lebensjahr zur Beratung und zahnärztlichen
Untersuchung angeschrieben. Etwa 30 Prozent nutzen dies. Der Zahnärztliche
Dienst geht auch in Kindergärten.
Gestärkt werden muß die Eigenverantwortung des Kindes für die kieferorthopädische
Behandlung. Die Eltern sollten dazu die gemeinsamen Beratungstermine
mit dem Kind beim Zahnarzt unbedingt wahrnehmen. Aber der junge Patient
sollte auch mal mit dem Zahnarzt/Kieferorthopäden alleine gelassen werden.
Festsitzende Behandlungsgeräte sind, was viele vielleicht zunächst vermuten,
keineswegs eine bequeme Alternative oder hilfreich gegen Nachlässigkeit
und mangelnde Motivation. Mit einer Zwangsbehandlung würde nichts gewonnen:
Oft ist der Behandlungserfolg von im Mund eingehängten Gummizügen oder
vom Tragen einer Außenspange abhängig. Und ohne eine ausgiebige Mundhygiene,
so heißt es, sei eine kieferorthopädische Behandlung mit festsitzendem
Gerät "undenkbar".
Eltern
sollten achten auf
° das Stillen ihrer Säuglinge. Es bedeutet
Vorsorge durch Kräftigung der Kaumuskulatur.
° das Daumenlutschen. Es kann einen "offenen
Biß" verursachen. Geben Sie dem
daumenlutschen den Säugling besser einen Beruhigungssauger.
Das Nuckeln spätestens mit
drei Jahren beenden.
° weitere schädliche Gewohnheiten wie: Beißen
oder Saugen an den Lippen; Fehlfunktionen der
Zunge oder falsche Schluckgewohnheiten führen ebenfalls zu Zahnfehlstellungen.
° die Gebißentwicklung: sie sollte nicht nur
vom Kinderarzt kontrolliert werden. Nur ausgeprägte
Fehlstellungen sind auch vom Laien gut zu erkennen.
° den vorzeitigen Verlust eines Milchbackenzahnes.
Schon ein einziger Verlust kann eine
Zahnstellungsanomalie auslösen: Die Seitenzähne rutschen nach
vorn, verengen den Platz für
bleibende Zähne;
das Milchgebiß muß den Platz für die bleibenden Zähne erhalten.
° Schäden an den Milchzähnen: Milchzähne auf
jeden Fall sanieren.
° den Zahnerhalt. Da hilft nur konsequente
und systematische Zahnreinigung von klein an sowie
eine Fluoridierung der Zähne und eine "zahngesunde Ernährung".
° Untersuchungstermine: Schon Kleinkinder sollten
ihre Eltern zum Zahnarzt begleiten und kariespro-
phylaktisch betreut werden: Sofern der Zahnarzt Fehlentwicklungen
des Gebisses beobachtet, können sie
schon früh an einen Kieferorthopäden überwiesen werden.
° Beschädigung oder Verlust der Spange: Bei
"Gewohnheitstätern" zahlt die Kasse nicht mehr. |
Welche Spange für wen ?
Noch werden mehr herausnehmbare Spangen verordnet, doch es gibt eine
Tendenz zu festen Spangen: Diese technisch aufwendigeren Verfahren führen
rascher zum Erfolg, das Ergebnis ist präziser bestimmbar. Allerdings
stellen sie auch besondere Anforderungen an den Patienten.
Herausnehmbare Einzelkieferapparaturen ("aktive Platten")
haben ihre Vorteile bei der Behandlung Jugendlicher während des Wechsels
vom Milch- zum bleibenden Gebiß, wenn keine bleibenden Zähne entfernt
werden müssen.teile der herausnehmbaren Systeme sind u. a., daß Schäden
an den Zähnen meistens vermieden werden und daß die Reinigung einfacher
ist.
 |
Herausnehmbare
Spange zur
Zahnkorrektur.
Über die Spangenart entscheiden
die medizinische Indikation und
meist auch die Erfahrung des
Behandlers. |
Ein Nachteil kann sein, daß Stellungsänderungen der Wurzel kaum erreichbar
oder Zähne nicht achsengerecht in Lücken "hineinzuschieben"
sind. Das Bewegen von Zähnen entlang ihrer Längsachse in den Knochen
ist mit "aktiven" Platten nicht möglich.
Diese Aufgabenstellung ergibt sich häufig bei "mittelalterlichen"
Erwachsenen. Insofern ist es unverständlich, daß gerade sie oft noch
mit herausnehmbaren Spangen behandelt werden.
Brackets und Bögen
Festsitzende Apparaturen gibt es in den unterschiedlichsten Formen,
zum Teil als Multiband oder Multibrackettechnik bezeichnet. Optisch
oft recht auffällig, ziehen sie eine vorübergehende Veränderung der
Bakterienflora in der Mundhöhle nach sich, der durch vermehrtes Zähneputzen
begegnet werden muß.
Bis auf einige Ausnahmen haben sich heute als Alternative zu den Bändern,
die den ganzen Zahn umfassen, sogenannte Brackets durchgesetzt. Meist
aus Stahl (auch im Miniformat), werden sie auf die Zähne geklebt und
sind optisch etwas weniger auffällig als Bänder. Passend zu zahnfarbenen
Brackets gibt es auch zahnfarbene oder durchsichtige Bögen, die jedoch
nicht bei jedem Patienten angewendet werden können. Einige Bracketkleber
setzen zur Verbesserung der Mundhygiene Fluoride frei.
Brackets sind Hilfsmittel. Bewegt werden die Zähne durch Druck und Zugfedern,
federnde Drähte, elastische Gummizüge etc.
Zahnfarbene Kunststoffbrackets kosten etwas mehr und Keramikbrackets
ein Mehrfaches von Stahlbrackets. Die Kosten werden von den Kassen nicht
übernommen. Brackets können - völlig unsichtbar - auch auf die Innenseite
der Zähne geklebt werden, ein in Hollywood entwickeltes Verfahren, dessen
Mehrkosten von der Kasse jedoch ebenfalls nicht bezahlt werden.
Stahl gilt als optimales Material. Kunststoffbrackets verformen sich
eher, Keramikbrackets, optisch unübertroffen, sind recht spröde und
können brechen, so daß neue Kosten entstehen.
Alle Verfahren haben Vor- und Nachteile, die mit dem Kieferorthopäden
zu besprechen sind bzw. seine Entscheidung beeinflussen.
Zahnmedizinisch häufig äußerst sinnvoll - zum Beispiel beim Verschieben
aller Zähne des Oberkiefers nach hinten -, aber wenig beliebt, sind
Außenspangen ("Headgear", siehe Foto).
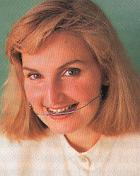 |
Erwachsene
mit Zahnspange
und Außenspange (Headgear)
bei Fehlstellung der Kiefer
zueinander.
Für eine Behandlung ist es
nie zu spät. |
Bei ihnen genügt es allerdings meist, sie zu Hause zu tragen. Diese
Spangen, die die Gegenkraft am Kopf abstützen, entwickeln die größten
und gleichmäßigsten Kräfte, und es gibt zu ihnen kaum eine Alternative:
Dazu zählt Zähneziehen oder eine spätere kieferchirurgische Korrektur
im Erwachsenenalter. Wichtig ist es, falls eine Außenspange notwendig
werden sollte, daß zumindest alle Familienmitglieder vorbehaltlos hinter
diesem Verfahren stehen.
Zahnspangen, ermöglichen jedenfalls optisch außerordentlich ansprechende
Ergebnisse. Konsequenz ist allerdings angesagt. Damit später, zum Beispiel
beim erwachsenen Patienten, die Zähne nicht mehr auf Wanderschaft gehen
- eine Gefahr insbesondere bei Engständen -, muß immer mal wieder Druck
ausgeübt werden: mit einer Haltespange, die jedoch nur nachts zu tragen
ist; für den Bereich der Seitenzähne mindestens mehrere Jahre, für den
der Frontzähne am besten ein Leben lang.